Fleischrinderzucht
Ist die Haltung von Rindern zur Fleischproduktion noch zeitgemäß? Steht sie gar in immer größer werdender Konkurrenz zur pflanzlichen Lebensmittelerzeugung für die stetig wachsende Weltbevölkerung?
Beides ist mit "nein" zu beantworten! Weltweit betrachtet sind gut zwei Drittel der landwirtschaftlich genutzten Flächen Dauergrünland, also Wiesen. In Deutschland sind es immerhin noch knapp ein Drittel. Diese Flächen können zur Lebensmittelproduktion nur von Wiederkäuern (Rindern, Schafen, Ziegen, usw.) genutzt werden. Ohne diese Nutzung würden die Flächen für die Herstellung von Lebensmitteln verloren gehen.

Wenn eine regionale Verwertung dieses Grünlandfutters – am besten von Tieren in Weidehaltung – sowie eine regionale Schlachtung und Vermarktung der Tiere stattfindet, dann ist Haltung von Fleischrindern definitiv zeitgemäß, nachhaltig und ressourcenschonend. Durch die Weidehaltung wird zudem Humus aufgebaut, was durch die damit einhergehende Bindung von CO² dem Klimawandel entgegenwirkt.
Wenn das Verhältnis von gehalten Tieren in einer ausgewogenen Relation zur bewirtschaften Fläche steht und sowohl bei bei der Futtererzeugung, als auch bei der Verarbeitung und Vermarktung der Tiere kurze Wege eingehalten werden, ist die Fleischrinderhaltung eine ökologisch vertretbare Art der Landbewirtschaftung.

Murnau-Werdenfelser-Rind
Das Murnau-Werdenfelser-Rind ist eine der ältesten Rinderrassen der Welt. Es wird auch als das "bayerische Urvieh" bezeichnet. Leider zählt es zu den extrem gefährdeten Nutztierrassen und war lange vom Aussterben bedroht.
Die Färbung der Tiere variiert von hellem Semmelgelb über Gelbbraun bis zu Rotbraun. Stiere sind meist dunkler gefärbt. Die Umgebung von Augen und Stirn ist dunkel gefärbt, ebenso wie Klauen, Schwanzquaste und Flotzmaul. Die geschwungenen, ausladenden Hörner sind weißlich gelb und im letzten Drittel schwarz gefärbt. Die Kühe erreichen ein Gewicht von 500 bis 600 Kilogramm, Bullen werden bis 950 Kilo schwer.
Die Entstehung der Murnau-Werdenfelser ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Wahrscheinlich haben die Vorfahren des heutigen Tiroler Grauviehs den Grundstock für die Rasse gebildet. Später wurde Grauvieh aus Graubünden, Schwyzer, Montafoner und Allgäuer, sowie Mürztaler und Murbodner aus der Steiermark und mittelfränkische Ellinger eingekreuzt.
Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Murnau-Werdenfelser als sogenanntes Dreinutzungsrind in der bayerischen Landwirtschaft weit verbreitet. Die Kühe lieferten Milch, die Ochsen erbrachten eine hohe Zugleistung und mit dem Verkauf des Fleischs an die wohlhabendere Bevölkerung sicherten sich die Landwirte ein wichtiges Zusatzeinkommen.
Mit der fortschreitenden Technisierung Mitte des 19. Jahrhunderts wandten sich die Landwirte mit Blick auf höhere Milch-Erträge jedoch den modernen Hochleistungsrassen wie Fleckvieh oder Braunvieh zu. Das Murnau-Werdenfelser geriet vielerorts in Vergessenheit und war eine Zeit lang sogar vom Aussterben bedroht. Ihre Zahl sank von knapp 62.000 (1896) auf 526 Tiere (1986) und im Jahr 2006 sogar auf nur 135 reinrassige Tiere. Das Murnau-Werdenfelser-Rind wurde zur Gefährdeten Nutztierrasse der Jahre 1986 und 2007 gewählt.

Dank des umfangreichen Engagements konnte sich der Bestand des Murnau-Werdenfelser-Rindes auf heute etwa 1400 Tiere erholen. Die Tendenz ist erfreulicherweise steigend. Dennoch steht es weiterhin als „extrem gefährdet“ auf der Roten Liste der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. (GEH).
Das Murnau-Werdenfelser Rind ist ein Passagier der Arche des Geschmacks. Das internationale Projekt der Slow Food Stiftung für Biodiversität schützt weltweit etwa 5.000 regional wertvolle Lebensmittel, Nutztierarten und Kulturpflanzen vor dem Vergessen und Verschwinden, die unter den gegenwärtigen ökonomischen Bedingungen am Markt nicht bestehen können oder "aus der Mode" gekommen sind.

Mutterkuhhaltung
Die Mutterkuhhaltung ist die natürlichste Form der Rinderhaltung, bei der die Kälber direkt bei der Kuh und im Herdenverbund aufwachsen.
Die Kälber werden in den ersten Lebensmonaten durch Muttermilch ernährt. Die Kühe werden nicht zur Milchproduktion gehalten, ihre Milch wird ausschließlich von ihren Kälbern getrunken. Derzeit wird jede siebte Kuh in Deutschland als Mutterkuh gehalten.
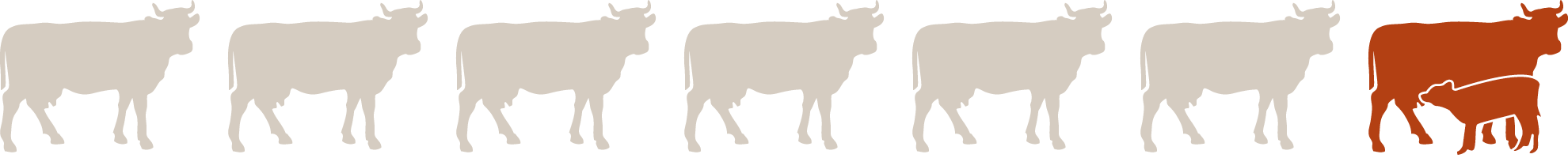
Die Abkalbesaison – die Zeit der Geburten – lässt sich steuern. Bei uns findet sie in den späten Wintermonaten statt. Hier können die Tiere gut betreut werden und die erste sensible Zeit im Stall auf Stroh verbringen. Murnau-Werdenfelser gelten jedoch als sehr unproblematisch und selbstständig bei Geburten und bei der Aufzucht ihrer Kälber. Zum Start der Weidehaltung ab etwa Mai grasen die Jungtiere und die Milch tritt als Nahrungsquelle in den Hintergrund. Die Mutterkuhherde ernährt sich in der Vegetationsperiode vom Aufwuchs der Weide, über die Wintermonate von biozertifiziertem Heu und Heulage, das ebenfalls von den eigenen Flächen geerntet wird.
Ein weiterer Vorteil der Mutterkuhhaltung ist der natürliche Herdenverband. Die Kühe leben mit ihren Kälbern von Frühjahr bis in den Herbst hinein auf der Weide. In der Herde gibt es soziale Strukturen und Hierarchien, in denen die jüngeren Tiere von den älteren lernen. Die Fortpflanzung erfolgt bei der Mutterkuhhaltung in der Regel auf natürlichem Weg – direkt durch den Stier, der für den fortpflanzungsrelevanten Zeitraum zusammen mit Kühen und Kälber gehalten wird. Auch dies fördert einen engen Herdenverband.
Die Mutterkuhhaltung ermöglicht die Erzeugung von Qualitätsrindfleisch in einer vom Verbraucher gewünschten Tierhaltungsform. Sie fördert die extensive Grünlandnutzung und leistet einen wichtigen Beitrag in der Landschaftspflege. Die Beweidung der Flächen von Frühjahr bis Herbst ist ein aktiver Beitrag zu mehr Artenvielfalt und Biodiversität. Wo Rinder grasen, da kommt es zu einer hervorragenden Symbiose mit anderen Tierarten, die die Flächen nutzen. Der anfallende Dung ist zum Beispiel Lebensraum für Insekten, die wiederum Nahrung für vielerlei Vogelarten sind.

Ochsenmast
Die prächtigen, kraftvollen Tiere wachsen artgerecht und langsam heran. Viel Bewegung auf den Weiden und gesundes Futter sind die Grundlage für das exzellente marmorierte Fleisch.
Ein Großteil der männlichen Nachzucht der Murnau-Werdenfelser wird heute kastriert und als Ochse gehalten. Damit werden Rangkämpfe unter mehreren Stieren vermieden. Durch das ruhige Gemüt der Ochsen wird der Herdverbund nicht gestört. Oftmals bilden aber auch die Ochsen und der Stier außerhalb dessen Deckzeit eine eigene Herde. Durch die Kastration und das langsamere Wachstum der Ochsen wird zudem ein besonders schmackhaftes und zartes Fleisch produziert.
Bei der Ochsenmast wird inzwischen darauf geachtet, züchterische Fehler aus der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts waren die prächtigen schweren Zugochsen sehr gefragt. Auch die Münchner Brauereien nutzten die zugkräftigen aber gutmütigen Tiere für ihre Gespanne. Die große Ochsenpopulation hat sich jedoch nachteilig für die Zuchtentwicklung ausgewirkt. Die meisten – und sehr häufig auch die besten – Stierkälber wurden zur Ochsenaufzucht verwendet und gingen dadurch der Zucht verloren. Dies trug mit zur Gefährdung der Rasse bei, eine reinrassige Nachzucht kam fast zum Erliegen.
Unsere Ochsen – wie auch unsere Mutterkühe und Kälber – verbringen ihre Sommer auf den hofeigenen Weiden und die kalte Jahreszeit im Stall auf Tiefstreu, wo sie mit biozertifiziertem Heu und Heulage gefüttert werden, das wir von unseren Wiesenflächen ernten.
Das hochwertige Futter sowie viel Bewegung auf der Weide bilden die Grundlagen für das marmorierte Fleisch. Die wertvollen Fetteinschlüsse im dunkelroten Muskelfleisch zählen zu den wesentlichen Qualitätsmerkmalen und sind beim Murnau Werdenfelser-Rind überdurchschnittlich stark ausgeprägt.
Ökologischer Landbau
Öko liegt im Trend. Immer mehr Betriebe stellen um und die Nachfrage auf Seiten der Verbraucher*innen steigt. Einst wurde die ökologische Landwirtschaft belächelt. Inzwischen werden die Rufe nach einer Veränderung in der Landwirtschaft lauter.
Im ökologischen Landbau steht das Vorbeugen im Vordergrund, nicht die Bekämpfung von Schädlingen. Standort- und Sortenwahl, Bodenbearbeitung, Fruchtwechsel, Düngung und andere zentrale Kulturmaßnahmen sollten so ausgerichtet sein, dass die Pflanzen gesund und möglichst widerstandsfähig gegen Schädlinge sind. Durch moderate Anbauweisen werden zudem Ressourcen geschont, die Artenvielfalt gefördert und die Umwelt geschützt. Geringere Erträge als bei konventioneller Bewirtschaftung müssen jedoch einkalkuliert werden.
Im Jahr 2020 wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 1,59 Mio. ha bzw. 9,6 % der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche ökologisch bewirtschaftet. Die "Zukunftstrategie ökologischer Landbau (ZöL)" des BMEL soll dazu beitragen, das 30 %-Ziel der Bundesregierung bis 2030 zu erreichen. Allerdings würden auch dann noch 70 % der landwirtschaftlichen Flächen konventionell bestellt werden. Um die nationalen Umweltziele zu erreichen, muss auch die konventionelle Landwirtschaft umweltverträglicher werden.

Wir bewirtschaften ausschließlich Grünland-Flächen, also Wiesen. Der Großteil dieser Wiesen dient unseren Murnau-Werdenfelser-Rindern vom späten Frühjahr bis in den Herbst als Weide. Der restliche Flächenteil wird als Mähwiese, zur Ernte von Heu und Heulage für die Fütterung in den Wintermonaten genutzt.

Biodiversität auf Wiesen
Einen Teil unserer Wiesen haben wir – in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Mühldorf – auf ehemaligen Ackerflächen als Dauergrünland neu angelegt. Hier wächst und blüht nun eine riesige Anzahl an unterschiedlichen Gräsern und Kräutern. Das Saatgut dafür wurde von nur wenigen Kilometern entfernten Wiesen gewonnen, welche von je her extensiv zur Heugewinnung mit keiner bzw. geringer Düngung genutzt werden und daher sehr artenreich sind.
Die Saatgutgewinnung erfolgte mit Spezialmaschinen, welche die reifen Samenstände der bis zu 50 verschiedenen Arten an Wiesenkräutern und –gräsern schonend ausbürsten und auffangen. Nur durch dieses Verfahren können lokaltypisch Pflanzensippen mit ihrer speziellen Anpassung an den jeweiligen Naturraum (z.B. Bodenart, Lokalklima) erhalten werden.
Diese Wiesen liefern nicht nur schmackhaftes und gesundes Futter für unsere Rinder, sondern sie dienen auch einer Vielzahl von Insekten und Wildlebewesen als Heimat und Nahrungsquelle. So versorgen Wiesen-Salbei, Wiesen-Glockenblume oder Ferkelkraut Blütenbesucher wie Schmetterlinge und Wildbienen mit Nektar und Kamm- und Ruchgras bilden die Nahrungsgrundlage für Heuschrecken.
Wir möchten einen Beitrag leisten, um den Rückgang artenreicher Wiesen in unserer Kulturlandschaft zu mindern.

EU-Öko- und Bioland-Betrieb
Wir bewirtschaften unseren Hof nach den Vorgaben der EU-Öko-Verordnung, Kontrollstelle DE-ÖKO-006. Außerdem sind wir Mitglied im Anbauverbands Bioland e.V., dem größten ökologischen Anbauverband in Deutschland.
Die Wirtschaftsweise der Bioland-Betriebe basiert auf einer Kreislaufwirtschaft, die ohne synthetische Pestizide und chemisch-synthetische Stickstoffdünger auskommt. Die Richtlinien von Bioland sind strenger als die der Öko-Verordnung der Europäischen Union. Beispielsweise dürfen Bioland-Betriebe zum biologischen Anbau parallel keinen konventionellen Anbau betreiben, auch wenn beide Anbauarten voneinander getrennt sind. Insgesamt setzt Bioland sieben Grundprinzipien für die biologische Landwirtschaft fest.

Regelmäßig kontrollieren und zertifizieren lassen wir unsere Bewirtschaftung durch die staatlich anerkannte Kontrollstelle ABCERT AG. Sind alle Anforderungen der EU-Öko-Verordnung sowie die Vorgaben für den Anbauverband Bioland e.V. erfüllt, dann erst dürfen wir unsere Produkte als "Bio" oder "Öko" bezeichnen.
